
Anzeige
Erster Elektrowagen der Welt auf IAA mobility
Intelligenz, wie man gestern schon an morgen dachte und Innovation erschuf.
Schon im Februar haben wir im COBURGER ausführlich über den Nachbau des vermutlich ersten vierrädrigen Elektrowagens der Welt aus Coburg aus dem Jahr 1888 berichtet. Jetzt rollte er auf die große Bühne und zeigte sich auf der IAA Mobility in München. Die Begeisterung war groß.
Ein Wagen, zwei Fotos, 135 Jahre Geschichte: Auf der IAA Mobility in München sorgte der Nachbau des „Flocken Elektrowagens“ von 1888 für staunende Gesichter. Tausende Besucher erfuhren, dass nicht Benz oder Daimler die Elektromobilität erfanden, sondern ein Coburger Tüftler: Andreas Flocken. Sein mutiger Schritt, elektrische Energie mobil zu machen, war nicht nur ein Stück deutscher Ingenieurskunst, sondern auch ein Beweis, dass Zukunft immer aus dem Mut entsteht, das Neue zu wagen.
Bratwurst, Samba-Festival, Veste. Damit verbindet man Coburg. Zwei, drei große Unternehmen noch, fertig. Aber Elektroautos? Kaum jemand käme auf die Idee, die Wiege der derzeit so allgegenwärtigen Elektromobilität in der Vestestadt zu verorten. Und doch ist genau hier, im Jahr 1888, eine automobile Revolution gestartet. Andreas Flocken, Sohn eines Landmaschinenbauers, baute das, was heute als der erste vierrädrige Elektrowagen der Welt gilt.
Ein Stück Pioniergeist, das lange in Vergessenheit geraten war – bis ein Coburger Team von Enthusiasten es zurück ins Rampenlicht geholt hat zu einer Zeit, in der alle Hersteller Elektrofahrzeuge als Innovation präsentieren, obwohl sie doch eigentlich älter sind als Verbrenner.

Die IAA Mobility in München, Bühne der internationalen Automobilindustrie, wurde zum Ort der Wiederauferstehung. Im Pavillon des Bayerischen Wirtschaft sministeriums stand plötzlich ein Wagen, der gleichzeitig Relikt und Vision ist: der originalgetreu nachgebaute Flocken Elektrowagen. Wer ihn sah, blieb stehen, schaute zweimal hin – und lächelte. „Sobald die Menschen das Fahrzeug erblicken, kommt ein Strahlen ins Gesicht“, schildert Gerhard Kampe von Making Culture e.V., dem Träger des Projekts.
„Die Wiege der Elektromobilität steht in Coburg.“ Tobias Gotthardt, Staatssekretär im Bayerischen Wirtschaftsministerium
Das Staunen hatte gute Gründe. Mit nur zwei überlieferten Fotos als Basis gelang es den Coburgern, den Wagen detailgetreu zu rekonstruieren. „Wir hatten keine Planzeichnungen, keine Originalteile“, erzählt Rolf Sander, einer der Köpfe des Projekts. „Und trotzdem sollte das Auto nicht nur ein Anschauungsobjekt sein, sondern fahren.“ Dass es fährt, bewies der Wagen bereits bei seiner Jungfernfahrt auf dem Hof der Firma Lasco, die das Projekt großzügig unterstützte – ein Moment, den die Beteiligten „fast nicht in Worte fassen“ konnten.
In München nun erlebte der Wagen seine erste große Öffentlichkeit. Tausende Besucher drängten sich, hörten zu, staunten. „Ich bin tief beeindruckt“, sagt Christian Schlee, ehemaliger Ingenieur bei einem Automobilhersteller. „Vor allen Dingen, dass das schon so früh, also vor der Benz-Phase war. Eine innovative Lösung aus der Kutschenentwicklung heraus – und heute meisterhaft nachgebaut.“ Noch deutlicher formuliert es Christian Graf, Automobilfan aus Regensburg: „Alle reden, Elektromobilität sei eine neue Technologie. Aber sie ist eine alte, etablierte – und sie funktioniert.“ Tatsächlich war das Netz an Energiepunkten schon im 19. Jahrhundert gedacht: Wind- und Wassermühlen luden Batterien nach, alle 20 bis 30 Kilometer. Was heute als Herausforderung diskutiert wird, hatte Andreas Flocken visionär im Blick.
Dass Coburg damit mehr ist als eine beschauliche Residenzstadt, betont auch Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt: „Es ist faszinierend, was damals schon möglich war, fernab der großen Metropolen. Und man kann stolz sein: Die Wiege der Elektromobilität steht in Coburg.“ Auch Eric Rösner, Geschäftsführer der Coburger Wirtschaftsförderung, sieht die Chance, Geschichte und Zukunft zu verbinden: „Es zeigt, dass in Coburg schon immer schlaue Köpfe gelebt haben – und dass wir auch heute eine aktive Gründerszene haben. Das macht Mut für die Zukunft .“
Die Begeisterung in München war mehr als nostalgisches Schmunzeln. Sie war Erinnerung und Zukunftsvision zugleich. Erinnerung an einen Mann, der vor 135 Jahren mutig genug war, neue Wege zu gehen. Zukunftsvision, weil der Wagen zeigte, dass Innovation nicht zwangsläufig ein Silicon-Valley-Phänomen ist, sondern auch aus einer fränkischen Kleinstadt kommen kann.

So wurde der Flocken Elektrowagen zum Symbol einer Idee: dass Fortschritt immer dort beginnt, wo jemand wagt, das Bekannte zu verlassen. Für Coburg ist es die Chance, dieses Erbe zu pflegen – und sich als „Futureum“ der Industriekultur zu präsentieren. Für die Besucher der IAA war esschlicht ein Erlebnis. „Es funktioniert, und es begeistert“, wie einer von ihnen sagte. Und während draußen die neuesten Elektro-SUVs im Glanzlicht standen, war es ein Wagen mit filigranen Speichenrädern und hölzerner Kutsche, der das größte Raunen auslöste.
„Elektromobilität ist keine neue, sondern eine alte, etablierte Technologie.“ Christian Graf (Besucher)
Dieser Beitrag wird unterstützt von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg, von Making Culture und von der Firma Lasco.
Der Elektrowagen nach Flocken
Der Flocken Elektrowagen von 1888 gilt als das vermutlich erste vierrädrige Elektroauto der Welt. Sein Schöpfer, der Coburger Unternehmer Andreas Flocken, verband Kutschenbau mit modernster Elektrotechnik seiner Zeit. Antrieb: Das Original besaß einen Hauptschluss-Gleichstrommotor mit rund 1 kW Leistung – vergleichbar mit den Anfängen moderner Elektrofahrzeuge. Der Nachbau nutzt einen Motor baugleicher Art, gewonnen aus einem Thüringer Museum.
Energiequelle: Die Stromversorgung erfolgte über Tudor-Akkumulatoren, frühe Blei-Säure-Batterien. Sie ermöglichten Reichweiten von etwa 20–30 Kilometern – erstaunlich für die Zeit. Für den Nachbau wurde das Innenleben modernisiert, das Äußere aber originalgetreu rekonstruiert. Karosserie: Die Wagenform orientiert sich an einer Kutsche des Coburger Unternehmens Blümlein. Leichte Holzbauweise, fi ligrane Speichenräder und eine offene Sitzbank prägten das Design. Steuerung und Technik: Besondere Innovationen waren eine frühe Form der Differenzialtechnik und eine Stufenlenkung. Damit war der Wagen nicht nur mobil, sondern auch erstaunlich fahrstabil. Leistung: Maximalgeschwindigkeit ca. 15 km/h – damals ausreichend, um Pferdekutschen im Alltag zu überholen.
Ein Futureum für Coburg?
Gerhard Kampe, Making Culture e.V.: „Das wäre ein großer Wunsch für Coburg, dass man diese Chance aufgreift und darstellt, dass Coburg die Keimzelle der Elektromobilität ist. Ein weiterer Wunsch wäre, dass man nicht nur Flockens Leistungen zeigt, sondern überhaupt ein Zentrum schaff t für Industriekultur, gestern, heute, morgen. Wir haben dazu auch schon ein Konzept entwickelt. Wir nennen das Futureum Coburg.
Denn es gibt so viele Unternehmen, bei denen ganz innovative Entwicklungen in den Unternehmensmuseen lagern. Es wäre toll, das auch zu sehen. Und auch das, was im Moment gemacht wird und was es darüber hinaus aber auch für Zukunftsprojekte gibt.“
Eric Rösner, Geschäftsführer Wirtschaftsförderungsgesellschaft Coburg: „Natürlich ist das ein Instrument, das man für Marketingzwecke nutzen kann. Ich denke, wir müssen einfach mal die Köpfe zusammenstecken, wie wir das dann zukünftig auch auf den Weg bringen.“
Tobias Gotthardt, Bayerisches Wirtschaftsministerium: „Man kann stolz darauf sein, auf die klugen Köpfe, die man über die Jahrhunderte hatte in der Region und weiterhin hat. Und man kann es natürlich als Werbeträger nehmen und sagen, Innovation war schon immer in Coburg zu Hause.“
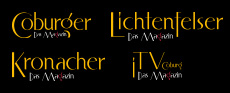

Neueste Kommentare