
Alte Gruben einfach zuschütten funktioniert nicht, denn das Wasser wird immer da sein. Bekommt es keinen Weg, sucht es sich einen. In Stockheim entsteht ein unterirdischer Bypass, um das Wasser ableiten zu können, das sich in den alten Stollen des Steinkohlereviers sammelt. Ein Besuch im einzigen Steinkohlerevier in Bayern 30 Meter unter der Erde.
Hier war das einzige Steinkohlerevier in Süddeutschland. Robin Hoffmann arbeitet im Bergamt Nordbayern und ist in unter anderem für den Altbergbau zuständig. „Bergleute fahren immer“, sagt er und steigt in einen Gitterkorb, der neben dem St.-Katharina-Förderschacht steht. Auch wenn er die Holzleitern nehmen würde, würde er hinunter „fahren“. Doch die Holzleitern werden gerade erneuert, die Feuchtigkeit hat ihnen zugesetzt. Der Einstieg liegt neben der alten Rentei, die als Kultur- und Begegnungsstätte in neuem Glanz erstrahlt. Drumherum liegen ein Kinderspielplatz und auch die alte Öffnung in den Königlich Bayerischen Maximilian Erbstollen.
Martin Normann ist so etwas wie Bayerns letzter Bergmann. Mit dem Meißel treibt er den Stollen voran. Das geht Meter für Meter. Mit einer Fernbedienung steuert er die Maschine. Wenn er genug zusammen hat, holt der Minibagger den Abraum und fährt ihn zum Schacht. 34 Meter unter der Erde bohrt er sich voran. Es ist hell, matschig und geräumig. Der Bergbau in Stockheim begann vor über 250 Jahren, 1756, und der Maximilian Erbstollen war ab 1804 die Hauptentwässerung. 50 Jahre lang verlängerten die Bergleute den Stollen, bis er 1855 alle Gruben im Revier erreichte und eine Gesamtlänge von über zweieinhalb Kilometern hatte. Er tat seinen Dienst bis 1968, als der Bergbau in Stockheim endgültig eingestellt wurde. Wenn ein Berg mit Stollen durchzogen ist wie ein Körper mit Adern, dann ist daraus ein Organismus geworden, der nicht einfach vergessen oder zugeschüttet werden kann. Er lebt – und er lebt vor allem durch das Wasser.

Ein Querstollen zeigt, wie das früher war – und warum der Stollen mit dem königlichen Namen nun einen stattlichen Bypass bekommt. Ein paar handbreit Luft sind da noch, einige Holzbalken sind eingestürzt. Hoffmann leuchtet mit einer Taschenlampe in die Abschnitte, die nicht vom Licht des neuen Schachtes erhellt werden. Mit seinen Gummistiefeln steht er dabei im Schlamm. Mit viel Kies haben die Verantwortlichen in den frühen 1970er-Jahren versucht, die Löcher zu stopfen, die zwei Jahrhunderte einer ganzen Region Arbeit gegeben hatten. Ein Schwarzweiß-Foto zeigt noch die Kiesberge vor dem Schacht. Doch das Wasser ist geblieben. Ein Teil davon fließt durch einen kleinen Nebenstollen in die Haßlach ab. „Rösche“ nennen die Bergleute diese Bauwerke, die das Arbeiten unter Tage erst ermöglicht haben. Natürlich muss ein Stollen halten, damals wie heute. Doch wenn das Wasser kommt und nicht abfließen kann, ist erstmal Schluss. Hoffmann zeigt in dem neuen Stollen auf eine Linie kurz unter der Decke: „Wir hatten in dem neuen Stollen vergangenen Winter einen Wassereinbruch. So hoch stand das Wasser in dem Stollen.“

Die Wunden aus der Zeit des Bergbaus sollten verschlossen werden, sie sollten verschwinden. Etwas Erinnerung darf bleiben, wie die Bergmannskapelle Stockheim oder die Traditionen und Erinnerungsstücke, die der Förderverein für Bergbaugeschichte sammelt und zugänglich machen möchte. Es gibt Themenwege, auf denen man oberirdisch die unterirdische Geschichte ablaufen kann. Es gibt sonntags Führungen des Fördervereins im Bergbaumagazin. Aber solange das Wasser nicht abfließt, werden die alten Wunden sie nicht heilen, sondern immer wieder aufbrechen. Das Wasser staut sich dann irgendwo unterirdisch auf und bricht unkontrolliert ins Freie, wenn der Druck zu groß wird.

Die Aufgabe von Hoffmann ist es, genau das zu verhindern. „Der Erbstollen kann diese Aufgabe nicht mehr leisten“, sagt er. Also machte sich das Bergamt ein Bild der Lage und plante einen neuen Stollen als Bypass für die frühere Lebensader eines ganzen Reviers. Zwei Schächte sind als Zugang für Material und für frische Luft unter der Erde notwendig. Neben dem St.-Katharina-Schacht, durch den Hoffmann in die Tiefe fuhr, ist das am anderen Ende des Stollens der Christopherschacht in der Nähe des Friedhofs. Etwas mehr als 240 Meter liegen liegen zwischen den beiden Ein- und Ausgängen ans Tageslicht.

Trotz aller Voruntersuchungen ist es unmöglich, genau vorherzusagen, was einem unter Tage begegnet. Ist der Stein fest, genügt eine aufgespritzte Betonschicht, andernfalls sind aufwändigere Konstruktionen notwendig. Bis Bayerns größte Bergbau-Baustelle fertig ist, werden durch den gleichen Schacht, durch den Hoffmann eingefahren ist, über 2500 Kubikmeter Gestein in kleinen Loren hinaufbefördert sein. Später, wenn der Stollen und der ganze Bypass fertig sind, läuft in dem Stollen einfach nur ein Rohr, in dem das Wasser ablaufen kann, das sich in dem ehemaligen Revier unterirdisch sammelt. Hoffmann wird bleiben: „Wir haben hier eine Ewigkeitslast.“
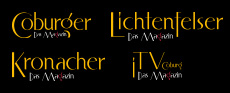

Neueste Kommentare