
Brücken bauen in eine friedliche Zukunft
Tetyana Lutsyk und ihr Engagement gegen das Vergessen
Wenn um fünf Uhr morgens das Telefon klingelt, bedeutet das selten Gutes. Für Tetyana Lutsyk war es der Moment, in dem sich ihr Leben teilte: in ein Davor und ein Danach. Ihr Vater rief aus Kiew an. Sie war im ersten Moment genervt über den frühen Anruf. „Kind, wir haben Krieg“, sagte er. Dann sieht sie die Bilder aus ihrer Heimat: Einschläge, Rauch, Menschen auf der Flucht. Es war der 24. Februar 2022. Ein Tag, der alles veränderte.
Seit 27 Jahren lebt Tetyana Lutsyk in Deutschland. Geboren in Kiew, kam sie zum Studium nach Hamburg und Leipzig, lernte später in Frankfurt ihren Mann kennen – einen Franken. Als dieser nach Hause zurückwollte, zog das Paar nach Coburg. Heute unterrichtet sie Wirtschaft an einer Berufsschule in Schweinfurt, ist bayerische Beamtin und Mutter zweier Töchter. „Ich bin stolz darauf, Beamtin in Bayern zu sein“, sagt sie, mit leichtem Akzent, aber mit fester Stimme. Deutschland ist ihre Heimat geworden. Doch die Ukraine ist ihre Herkunft. Und seit jenem Anruf am frühen Morgen ist sie präsenter denn je. „Früher wollte ich einfach dazugehören. Ich habe versucht, nicht aufzufallen, so deutsch wie möglich zu sein“, erzählt sie. Sie engagierte sich im Alpenverein, kletterte mit Kindern, lebte ein ganz normales Leben. Und tut das bis heute. Doch mit dem Krieg begann ein weiteres Leben. „Seit damals gebe ich zu erkennen, dass ich Ukrainerin bin.“ Sie kocht anders, kleidet sich anders, denkt anders. Und vor allem: Sie tut etwas.
In den ersten Wochen nach Kriegsbeginn war sie überwältigt von der Hilfsbereitschaft. „Menschen haben sich bei mir gemeldet, die ich seit Jahren nicht gesehen hatte. Alle wollten helfen.“ Sie selbst stellte sich viele Fragen: Was kann ich tun? Wie kann ich helfen – hier, von Coburg aus? So wurde sie zur Ansprechpartnerin, zur Brückenbauerin, zur Organisatorin. Sie übersetzte, half Geflüchteten. „Ich habe damals Natalia kennengelernt, eine Ukrainerin mit zwei Kindern, die geflohen war. Wir haben zusammen viel auf die Beine gestellt.“

Gemeinsam mit anderen Coburgerinnen und Coburgern organisierte Tetyana eine Ausstellung am Albertsplatz – Porträts von Geflüchteten, mitten in der Stadt. „Wenn der Februar naht, denke ich jedes Jahr: Was können wir dieses Mal machen?“ In diesem Jahr war es eine Fotoausstellung von Kriegsreporter Till Mayer. Viele Besucher kamen zum Vortrag und zur Ausstellung. Ihre Motivation: „Ich habe befürchtet, dass der Krieg aus dem Bewusstsein der Menschen hier verschwindet. Und ich wollte das nicht zulassen.“ Sie versteht aber auch die Müdigkeit. „Natürlich verstehe ich Menschen, die sagen: Ich habe es satt. Ich will nichts mehr hören. Aber der Krieg geht eben immer weiter. Und weiter.“
Die Ukraine ist für viele Deutsche ein ferner Ort geworden – eine abstrakte Schlagzeile zwischen Energiekrise und Wahlkampf. Für Tetyana ist sie tägliche Realität. Ihre Eltern leben dort, ihr Bruder mit seiner Familie. Freunde, Bekannte. „Ich bin oft dort, fahre mit dem Auto. Tagsüber ist in Kiew ein spannendes Leben. Die jungen Menschen sind unglaublich engagiert, diskutieren über Nachhaltigkeit, veganes Leben, Demokratie, sie sind so zukunftsorientiert.“ In Kiew hat sie mit Jugendlichen Tarnnetze für die Armee geknüpft . „Es war spannend, mit diesen jungen Menschen zu arbeiten.“ Die Ukraine ist nicht stehen geblieben, betont sie fast zornig und denkt an einen Vortrag in Coburg. „Ein Mann hat dort gesagt, die Ukraine heute sehe aus wie im Zweiten Weltkrieg, weil er alte Fotos seines Vaters gefunden hat. Ich wäre fast geplatzt. Die Ukraine hat sich so stark verändert, modernisiert.“ Es gibt Apps, über die man alle Behördengänge erledigen kann, sogar heiraten. Die Ukraine hat sich auf den Weg in die Zukunft in Europa gemacht, sagt sie, „wir sind auch zivilgesellschaftlich stärker als je zuvor. Es gibt viele Gruppen, die sich gegen Korruption engagieren. Wer Missstände aufdeckt, wird sogar ausgezeichnet.“ Tetyana nutzt selbst ukrainische Apps, um sich über Kämpfe und Gefahrenzonen zu informieren.
„Damit ich ein Gefühl dafür bekomme, wie es vor Ort ist.“ Es sei erschreckend, wie sehr man sich an den Krieg gewöhne, sagt sie leise. „Wenn Beschuss ist, kann man nicht schlafen, die ganze Stadt bebt, ich war selbst oft da, alles ist laut, das ist nicht beschreibbar, da schläft keiner.“ Ihr Vater geht nicht mehr in den Schutzraum. Ihr Bruder sieht die Raketen vom Fenster aus. Angst hat er kaum noch. „Man verdrängt. Aber ich checke jeden Morgen auf Telegram, wie die Nacht war. Ob Luftalarm war.“ Manchmal telefoniert sie mit ihrem Vater, während im Hintergrund Explosionen zu hören sind. „Es ist absurd. Aber so ist es eben. Das ist der Alltag dort.“
Ihr Bruder war zeitweise an der Front, als Radiotechniker, um Funkverbindungen wiederherzustellen. Am Anfang war er überzeugt: „Wir werden gewinnen.“ Heute sagt er das nicht mehr. Der Krieg hat seine Gewissheiten erschüttert – wie bei so vielen. Tetyana setzt dagegen auf Begegnung. Auf Verbindung. Auf gemeinsame Projekte. „Ich glaube, wenn Ukrainer ein Teil des Lebens hier werden, hilft das beiden Seiten.“ Sie träumt von Städtepartnerschaft en, Schüleraustausch, gemeinsamen Veranstaltungen. Beim Alpenverein hat sie mit ihrer Klettergruppe eine Stadtmeisterschaft organisiert. Die Kinder erkletterten Spendengelder für eine zerstörte Kletterhalle in Charkiw. „Die Kinder werden das nie vergessen. Sie sagen: Nach dem Krieg fahren wir hin und schauen es uns an.“ Auch eine kulinarische Aktion hat sie organisiert: eine ukrainische Woche in verschiedenen Coburger Restaurants. „Die Resonanz war gut. So schafft man Nähe.“ Nähe, die ihr besonders wichtig ist – in einer Zeit, in der Vorurteile und Erschöpfung wachsen. „Wenn dann gesagt wird, wir Ukrainer sitzen hier nur rum und tun nichts, dann tut das weh. Viele können nicht zurück. Weil ihre Häuser zerbombt sind.“
Tetyana ist keine laute Frau. Aber sie ist unbeirrbar. „In meiner Welt stelle ich mir vor, dass klar ist, dass man die Ukraine nicht alleinlassen darf.“ Sie weiß, dass es unbequem ist. Aber sie bleibt dabei: „Wenn man der Ukraine keine Waffen mehr liefert, hört der Krieg nicht auf. Er geht weiter.“ Was ihr bleibt, ist Hoffnung. Und das Tun. Jeden Tag ein bisschen. Und auch der Wunsch nach der Zeit danach. Nach dem Frieden. Nach Austausch. „Nach dem Krieg möchte ich einen Schüleraustausch organisieren“, sagt sie. Und man glaubt ihr sofort, dass sie das schaff en wird. Weil sie nicht aufhört, Brücken zu bauen – zwischen ihrer alten und ihrer neuen Heimat. Zwischen Kiew und Coburg. Zwischen Traum und Wirklichkeit.
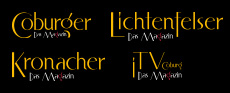

Neueste Kommentare