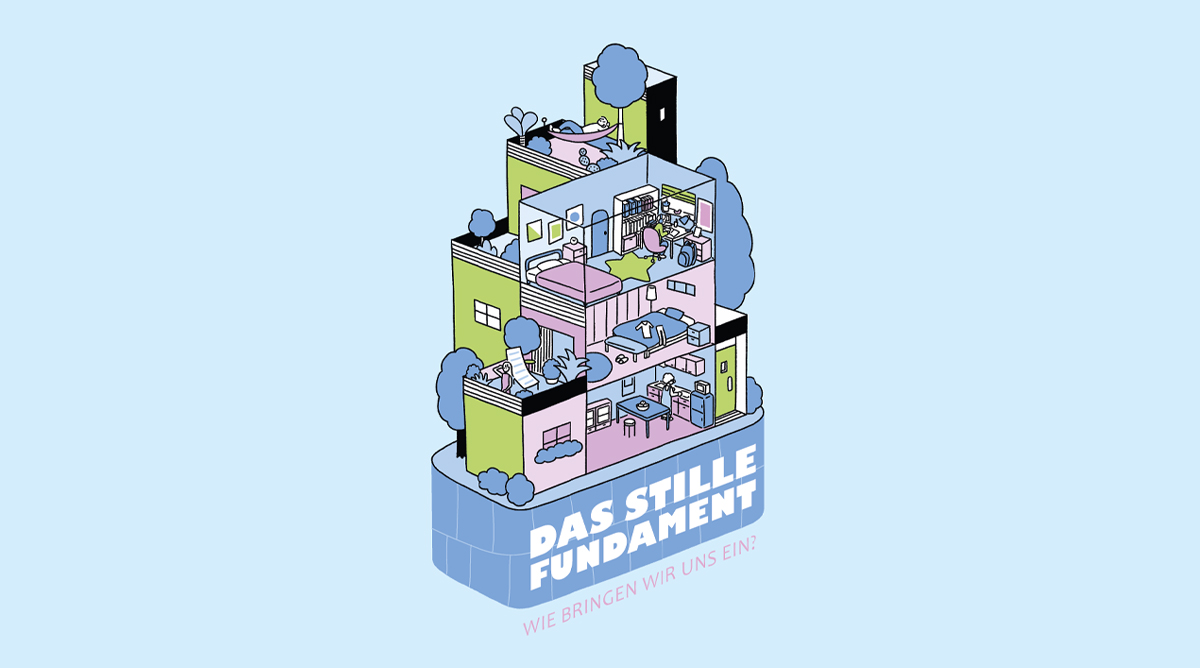
Leitartikel zum Sonderthema von Wolfram Hegen
Das stille Fundament
Es gibt Dinge, die so selbstverständlich erscheinen, dass man sie kaum bemerkt – bis sie fehlen. Das Ehrenamt gehört dazu. Es ist das unsichtbare Rückgrat einer Gesellschaft, die sich gern modern, effizient und digital nennt, aber ohne jene stillen Mitwirkenden, die ihre Zeit verschenken, längst ins Wanken geraten wäre. Vom Fußballtrainer bis zur Hospizhelferin, vom Feuerwehrmann bis zur Lesepatin: Millionen Menschen halten mit ihrem freiwilligen Engagement das soziale Gewebe zusammen, das uns verbindet.
DOCH WARUM TUN SIE DAS?
Warum engagiert sich jemand – ohne Bezahlung, oft ohne Anerkennung, manchmal sogar gegen Widerstände – für das Gemeinwohl? Die Geschichte zeigt: Freiwilligkeit ist keine Erfindung des modernen Sozialstaates. Schon in der Antike gründeten sich Bruderschaften, Zünfte und Vereine, in denen Menschen für andere eintraten, Tempel bauten oder Bedürftige versorgten. Im Mittelalter übernahmen Klöster soziale Aufgaben, lange bevor es kommunale Verwaltungen gab. Später schufen bürgerliche Vereine in der Aufbruchzeit des 19. Jahrhunderts Krankenhäuser, Feuerwehren, Bibliotheken. Das Ehrenamt war stets dort besonders lebendig, wo staatliche Strukturen schwach waren – und der menschliche Wille, Verantwortung zu übernehmen, stark. Studien zeigen, dass das Engagement in wohlhabenden Gesellschaften nicht zwangsläufig höher ist. Zwar haben Menschen mit gesicherter Existenz mehr Ressourcen, sich einzubringen – Zeit, Bildung, soziale Netzwerke – doch in Krisenzeiten, in denen Not sichtbar wird, wächst die Bereitschaft zu helfen oft sprunghaft. Nach Naturkatastrophen, in Kriegen oder Pandemien wird Solidarität plötzlich zur Bewegung. Vielleicht braucht der Mensch die Erfahrung des Mangels, um den Wert des Gebens zu erkennen.
UND WIE STEHT ES MIT DER ANERKENNUNG?
Wer sich ehrenamtlich engagiert, bekommt selten Applaus. Die Auszeichnungen sind rar, die Öffentlichkeit schweigt. Dabei wäre ohne diese freiwillige Arbeit vieles schlicht nicht möglich: Sportvereine, Tafeln, Rettungsdienste, kulturelle Initiativen, Nachbarschaftshilfen – sie alle leben von Menschen, die ihre Zeit schenken. Der ökonomische Wert dieses Engagements wird in Deutschland je nach Berechnungsmethode auf bis zu 72 Milliarden Euro jährlich geschätzt – eine Summe, die ahnen lässt, wie unbezahlbar es tatsächlich ist. Doch Geld ist nicht das Maß. Viele Ehrenamtliche berichten, dass sie selbst am meisten gewinnen: Sinn, Zugehörigkeit, Begegnung, das Gefühl, gebraucht zu werden. In einer Zeit, in der Arbeit oft entgrenzt und Anerkennung an Leistung gekoppelt wird, hat das Ehrenamt etwas Widerständiges. Es entzieht sich der Logik von Profit und Nutzen, und gerade darin liegt seine Kraft. Es zeigt, dass Gemeinsinn kein Anachronismus ist, sondern eine Zukunftsressource – und dass Menschsein mehr bedeutet als Teilhabe am Markt.
Vielleicht ist das Ehrenamt der stillste Ausdruck von Freiheit: frei zu entscheiden, etwas zu tun, ohne etwas dafür zu verlangen. Eine Gesellschaft, die das erkennt und würdigt, erkennt zugleich sich selbst. Denn ohne das Ehrenamt wäre sie nur ein Gefüge von Interessen. Mit ihm aber wird sie zu einer Gemeinschaft.
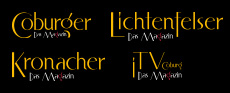

Neueste Kommentare