
Leitartikel zum Sonderthema
von Wolfram Hegen
Heimat – ein Wort, das wie frisch gebackenes Brot duftet, nach feuchtem Waldboden riecht und sich anfühlt wie ein alter Pullover, den man längst vergessen glaubte und plötzlich wiederfindet. Es ist ein Wort, das wärmt. Und zugleich eines, das irritiert. Heimat kann Wurzel sein – oder Fessel. Sie kann Geborgenheit schenken – oder Enge bedeuten. Wer sich auf die Frage einlässt, wo er sich zuhause fühlt, begibt sich auf eine Reise in die eigene Biografie, in die Tiefen der Erinnerung, in die stillen Winkel der Identität.
„Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss“, sagte einst der Schriftsteller Johann Gottfried Herder. Doch was, wenn man nie gelernt hat, sich irgendwo zuhause zu fühlen? Oder wenn das Zuhause, das man kannte, nicht mehr existiert – weil man selbst gegangen ist oder weil es verschwunden ist, im Wandel der Zeit, der Landschaft, der Gesellschaft? Wissenschaftlich betrachtet ist Heimat kein Ort, sondern ein Gefühl. Die Umweltpsychologie beschreibt Heimat als eine emotionale Beziehung zwischen Mensch und Raum, die durch Wiedererkennbarkeit, Sicherheit und soziale Verbindungen geprägt ist. Dabei geht es nicht nur um Kindheitsstraßen oder Muttersprache – sondern um das tiefe Gefühl, dazuzugehören. Der Soziologe Hartmut Rosa nennt Heimateinen „Resonanzraum“, einen Ort, an dem Welt und Mensch miteinander in Schwingung geraten. Heimat ist, wo das Außen das Innen berührt – und umgekehrt.
Doch gerade in einer Zeit, in der Menschen mobiler, Biografien brüchiger und Städte gesichtsloser werden, stellt sich die Heimatfrage neu. Kann man Heimat mehrfach haben? Können sich Menschen nach einer Heimat sehnen, die sie nie hatten? Ist Heimat ein Privileg der Sesshaften – oder eine Herausforderung für die Wandernden? Manche fühlen sich ihrer Herkunft unentrinnbar verbunden. Andere bauen sich neue Heimaten: im Freundeskreis, in der Musik, in einem Hobby, in der Sprache.
Und wieder andere erleben Heimat als politisches Schlachtfeld. Begriff e wie „Heimatministerium“ oder „Leitkultur“ zeigen, wie leicht das warme Gefühl kippen kann – in Ausschluss, in Ideologie, in Nationalismus. Der Schriftsteller Max Frisch hat einst notiert: „Heimat ist kein Ort. Heimat ist ein Zustand.“ Damit macht er deutlich: Heimat ist nicht das Fachwerkhaus oder der Kirchturm – es ist die Erfahrung von Vertrautheit, die in uns selbst entsteht. Interessant ist dabei auch, wie unterschiedlich Kulturen den Begriff „Heimat“ denken. Im Englischen gibt es keine direkte Übersetzung: „home“ meint eher das Zuhause, „homeland“ den Staat, „roots“ die Herkunft. Die deutsche Sprache kennt das Wort mit seiner ganzen romantischen Aufladung: „Heimat“ hat das Pathos des Waldes, des Dorfes, der Kindheit.
Aber es ist auch ein Ort der Utopie: Wie es wäre, wenn man irgendwo ganz man selbst sein dürfte – ohne Maske, ohne Verteidigung, ohne Angst. Heimat kann in einem Gespräch aufblitzen, in einem Lied, in einem Blick. Sie kann ein altes Foto sein oder ein vertrauter Dialekt. Sie kann in der Fremde entstehen, durch Nähe, durch Wiederholung, durch Mitgefühl. Der Philosoph Wilhelm Schmid spricht davon, dass der Mensch heute „Heimat bei sich selbst“ finden müsse – in einer Welt, die immer weniger feste Koordinaten bietet.
Und so bleibt die Frage: Wo fühlst Du Dich zuhause? In einem bestimmten Ort? In Menschen? In Erinnerungen? Oder in Momenten? Vielleicht ist Heimat gar kein fester Punkt, sondern eine Bewegung – ein zartes Band, das uns mit dem verbindet, was uns wichtig ist. Nicht dort, wo man geboren wurde, sondern dort, wo man verstanden wird. Nicht nur, wo man ist – sondern wo man sein darf.
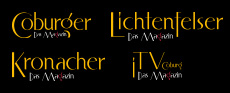

Neueste Kommentare