
Leichter gesagt als getan
Es gibt Worte, die allein schon beim Aussprechen die Schultern ein wenig sinken lassen, als könnte man mit ihnen einen Hauch Ballast abwerfen. Leichtigkeit ist so ein Wort. Leichtigkeit – das klingt nach beschwingten Schritten, nach einem heiteren Gemüt, nach einem Leben, das wie von selbst zu fließen scheint. Doch für viele Menschen ist dieses Gefühl weit entfernt. Stattdessen bestimmen Schwere, Stress, Überforderung und Sorgen das Erleben. Wie also kommen wir zu mehr Leichtigkeit? Und ist sie überhaupt erreichbar – oder bleibt sie ein Ideal, dem wir vergeblich nachjagen?
Gefühl oder Realität?
Leichtigkeit ist zunächst einmal ein Gefühl. Aber eines, das eng mit unserer Wahrnehmung von Realität verbunden ist. Die Psychologie beschreibt es als das Erleben von innerer Unbeschwertheit, Freiheit und Mühelosigkeit. Es ist das Gegenstück zur Belastung. Doch was uns belastet, ist nicht immer objektiv schwer. Studien zeigen: Zwei Menschen können in Situation sein – und der eine empfindet sie als bedrückend, der andere bleibt gelassen.
Die Wissenschaft hat sich in den letzten Jahren intensiv mit dem Thema Stressbewältigung und Wohlbefinden beschäftigt. Die Psychologin Sonja Lyubomirsky etwa, eine der führenden Forscherinnen auf dem Gebiet des Glücks, betont: „Wir unterschätzen, wie stark unsere Gedanken und Bewertungen unsere Emotionen bestimmen.“ Ihre Studien zeigen, dass rund 40 Prozent unseres Glückserlebens – und damit auch unseres Gefühls von Leichtigkeit – durch unser eigenes Denken und Handeln geprägt werden. Die Umstände?
Die machen überraschend wenig aus, oft nur 10 Prozent. Das bedeutet: Leichtigkeit ist keine rein äußere Gegebenheit. Es ist ein innerer Zustand, den wir aktiv kultivieren können. Doch das heißt nicht, dass reale Belastungen keine Rolle spielen. Im Gegenteil: Sie bilden den Hintergrund, vor dem wir Leichtigkeit überhaupt erst spüren – oder eben vermissen.
Belastung loslassen?
Hier wird es kompliziert. Können wir Dinge, Menschen, Zustände einfach hinter uns lassen, um leichter zu werden? Die Antwort lautet: manchmal ja – aber oft nur zum Teil. Die Psychotherapie kennt den Begriff der „emotionalen Distanzierung“. Gemeint ist damit nicht das Abwenden von der Welt, sondern das bewusste Entscheiden, sich von bestimmten Belastungen nicht mehr gefangen nehmen zu lassen. Die Forschung zur Achtsamkeit, etwa von JonKabat-Zinn oder Tania Singer, zeigt: Wer lernt, seine Gedanken und Gefühle wohlwollend wahrzunehmen, ohne sich mit ihnen zu identifizieren, empfindet weniger Schwere. Achtsamkeitstraining kann Stress reduzieren, wie zahlreiche Studien belegen – etwa eine große Meta-Analyse der Universität Oxford (2015), die zeigte, dass Achtsamkeit Depression, Angst und Stress messbar senken kann.
Auch das Loslassen im konkreten Sinn – toxische Beziehungen beenden, überfordernde Verpflichtungen reduzieren, stresserzeugende Umgebungen wechseln – führt zu mehr Leichtigkeit. Doch das ist leichter gesagt als getan. „Loslassen heißt nicht verdrängen“, mahnt der Psychologe Michael Bohne, Experte für Selbstwirksamkeit. „Es heißt, anerkennen, was ist – und dann entscheiden, was man verändern kann und was nicht.“
Glauben oder/und Haltung?
An diesem Punkt wird deutlich: Leichtigkeit ist mehr als nur das Ergebnis von „weniger Last“. Sie ist eine Haltung. Hier kommt auch der Glaube ins Spiel – sei es religiös oder philosophisch verstanden. Studien zeigen, dass Menschen mit einer spirituellen Anbindung oft resilienter gegenüber Stress sind. Sie erleben häufiger Momente von Sinn und Geborgenheit – Elemente, die das Gefühl von Leichtigkeit nähren. Ein Beispiel: Die sogenannte „Serenity Prayer“ – das Gelassenheitsgebet – wird in vielen therapeutischen Kontexten zitiert: „Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unter scheiden.“ Genau diese Mischung aus Akzeptanz und Gestaltungswille ist der Schlüssel zur Leichtigkeit.
Schwere und Leichtigkeit
Leichtigkeit ist also kein Zustand, der sich auf Knopfdruck her stellen lässt. Sie ist kein Dauerzustand, sondern eher ein flüchtiger Gast – aber einer, den man einladen kann. Sie entsteht dort, wo wir Belastung anerkennen, aber nicht übermächtig werden lassen. Wo wir loslassen, was nicht zu ändern ist, und gestalten, was wir können. Vielleicht ist Leichtigkeit am Ende weniger das Fehlen von Last als vielmehr die Kunst, mit ihr zu tanzen. Und wer tanzt, spürt: Schwere und Leichtigkeit gehören zusammen. Nur wer das eine kennt, kann das andere erleben.
Schritte zur Leichtigkeit
Was können wir konkret tun? Die Forschung liefert Hinweise: Bewusste Pausen und Atemtechniken helfen, Stress abzubauen. Eine Studie der Stanford University (2020) zeigte, dass bereits wenige Minuten langsamen, tiefen Atmens messbar den Stresspegel senken. Dankbarkeitstagebücher stärken den Fokus auf Positives. Forscher um Robert Emmons fanden heraus, dass Menschen, die täglich drei Dinge notieren, für die sie dankbar sind, mehr Lebensfreude und weniger depressive Symptome empfinden.
Reduktion von Multitasking: Unser Gehirn ist nicht für ständige Aufgabenwechsel gebaut. Studien der Universität Utah zeigen, dass Multitasking Stresslevel erhöht. Wer sich auf eine Sache konzentriert, erlebt eher Flow – ein Zustand, der mit Leichtigkeit verwandt ist. Sich erlauben, unperfekt zu sein: Perfektionismus ist ein Hauptfeind der Leichtigkeit. Der Psychologe Paul Hewitt hat herausgefunden, dass perfektionistische Menschen häufiger unter Angst, Depression und chronischem Stress leiden.
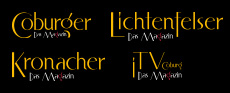

Neueste Kommentare